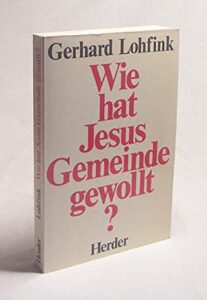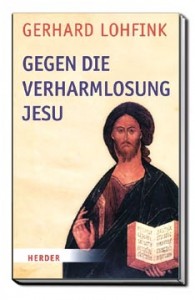
Wer ER wirklich ist
Haben die ersten Christen Jesus verstanden?
Vortrag: Prof. Dr. Gerhard Lohfink zum Thema
„Haben die ersten Christen Jesus verstanden?“
Das Flehen des Aussätzigen von Gerhard Lohfink
Gerhard Lohfink, Braucht Gott die Kirche?
DAS HEUTE DER GOTTESHERRSCHAFT
Wenn ich durch den Finger Gottes die Dämonen austreibe, dann ist die Herrschaft Gottes doch schon zu euch gekommen. (Lk 11.20)
Dämonen gibt es in vielen Formen. Vielleicht dürfen wir übersetzen: Wenn Menschen, die nicht mehr herauskönnen aus ihrer Besessenheit, ihren Obsessionen, den zerstörerischen Zwängen, die sich in ihnen und um sie herum aufgebaut haben, und zwar auf Grund des Bösen in der Gesellschaft und der Unheilsgeschichte, in der sie stehen – wenn solche
Menschen durch die Macht Jesu, die nichts anderes als die Macht Gottes ist, wieder atmen
können und frei werden und vertrauen können, dann ist die Herrschaft des Bösen bereits gebrochen und die Gottesherrschaft bei ihnen schon angekommen.
Denn die Basileia Gottes kommt nicht als Weltengewitter, nicht als universale Inszenierung vom Himmel her, sondern sie kommt in die Welt wie ein Saatkorn, das heranwächst.
In Jesu Heilungstaten wird das Heute des Gottesherrschaft schon sichtbar und greifbar.
Wenn Gott kommt, kommt er nicht halb, sondern ganz. Und er kommt nicht irgendwann, und sei es auch in allernächster Zukunft, sondern er kommt heute.
Man wird der Botschaft Jesu einfach nicht gerecht, wenn man so formuliert, als schenke Gott zwar seine Basileia – aber im Augenblick noch nicht ganz; als lasse er sie anbrechen – aber nur stückweise; als offenbare er sie – aber nur in Vorwegnahme… Dem Neuen Testament wird man nur gerecht, wenn man festhält: Gott hat sich in Jesus ganz ausgesagt.
Jesus ist die endgültige Gegenwart Gottes in der Welt. Wer ihn sieht, sieht den Vater (vgl. Joh 14,9). Das „Noch-nicht“ der Gottesherrschaft hängt nicht am Zögern Gottes,
sondern an der sich verzögernden Umkehr des Menschen. Der Mensch will Gott nicht
zu nahe haben. Er will lieber auf seiner eigenen Hochzeit tanzen als auf der Hochzeit, zu der Gott einlädt. So muß Jesus in einem Gleichnis erzählen (Lk 14.15-24), wie ein Mann ein Festmahl vorbereitet hat, wie er Sorge getragen hat um ein vorzügliches Essen und alles getan hat, dass seine Gäste glücklich sein könnten. Endlich ist es soweit – und die Gäste kommen nicht, obwohl sie seit langem eingeladen waren. Statt dessen trifft eine Entschuldigung nach der anderen ein: Ich habe einen Acker gekauft. Ich kann leider nicht kommen. Ich habe fünf Gespann Zugvieh gekauft. Ich kann leider nicht kommen. Ich habe gerade
geheiratet. Ich kann leider nicht kommen. Die Eingeladenen finden immer neue Entschuldigungen, wenn es darum geht, sich gegen den nahen Gott und die Sammlung des Gottesvolkes abzuschirmen (Jesus: Wer nicht sammelt, der zerstreut). Fast immer laufen sie hinaus auf den Satz: -Ich möchte ja. Aber im Augenblick geht es noch nicht!-. Das jesuanische „Heute“ besagt aber gerade: Du hast keine Zeit mehr. Denn die Welt brennt. Du musst jetzt handeln. Denn du bist der Sache Gottes begegnet. Du musst noch heute deine ganze Existenz einsetzen. Denn die Einladung Gottes ist an dich ergangen … Worauf Jesus mit dem „Heute“ zielt, ist nicht zuerst die Pflicht, der Imperativ, das moralische „Muß“, sondern der Jubel über das angebotene Fest, die Freude über den Schatz und die Perle, die man jetzt schon finden kann. Das Gleichnis sagt ja nicht: „Mit dem Reich Gottes verhält es sich wie mit einem Schatz, den einer fand. Er grub ihn wieder ein, ging voll Freude nach Hause und lebte fortan in dem glücklichen Wissen: Es gibt diesen Schatz, und irgendwann in der Zukunft werde ich ihn in der Hand haben“. Das Gleichnis erzählt vielmehr, wie der Mann den Schatz sofort an sich bringt: „In seiner Freude geht er hin, verkauft alles, was er besitzt,
und kauft den Acker (Mt 13,44).“ Der verborgene Schatz der Gottesherrschaft wird also jetzt schon ausgegraben. Und die kostbare Perle wird schon jetzt erworben. Das Fest will beginnen, und es hängt alles nur davon ab, ob die Eingeladenen auch kommen.
Vgl. U. Duchrow: Mission durch Attraktion.
Heinz Rudolf Kunze – Das Paradies ist hier
Peter Janssens – Kirche Wofür (1970)
Reich Gottes – jetzt !
Meine Vergangenheit kümmert mich nicht mehr, sie gehört dem göttlichen Erbarmen.
Meine Zukunft kümmert mich noch nicht, sie gehört der göttlichen Vorsehung. Was mich kümmert und fordert, ist das Heute. Das aber gehört der Gnade Gottes und der Hingabe meines guten Willens. Franz von Sales
KIRCHE GEHT AUF DAS GANZE
Gott zu Abraham (Gen 17.1):
Geh deinen Weg vor mir und sei ganz.
Gemeint ist aber weder im hebräischen Urtext noch in den Übersetzungen die moralische Vollkommenheit Abrahams, sondern sein Gottesverhältnis: Abraham soll in ungeteilter Hingabe vor dem Angesicht dieses offenbar gewordenen Gottes leben. Seid also ihr vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. (Mt 5,48). „Vollkommen“ darf hier so wenig wie im Alten Testament vom Vollkommenheitsideal des griechischen Menschen her verstanden werden. Nicht die autarke, auf der Höhe ihres Lebens stehende Persönlichkeit ist gemeint, die alle Tugenden besitzt und bei der sie so ausgereift sind, dass eine weitere Steigerung nicht mehr möglich ist. Die Hörer der Bergpredigt sollen die Tora, die ihnen jetzt von Jesus in ihrem endzeitlichen Sinn erschlossen wird, mit ihrer ganzen Existenz und ohne jede Zwiespältigkeit leben. Die Vollkommenheit, die von ihnen gefordert wird, hat ihr Maß an der Vollkommenheit Gottes, und so zeigt sich erst recht, dass es nicht um das griechische Vollkommenheitsideal geht. Denn die perfectio absoluta des göttlichen Seins anstreben zu müssen, wäre keine Ermutigung, sondern eher ein Grund zur Verzweiflung.
Matthäus meint etwas anderes: Die Hörer und Nachfolger Jesu dürfen sich ganz und ungeteilt dem Willen Gottes hingeben, weil sich Gott schon zuvor ganz und ungeteilt und ohne Unterschiede zu machen den Menschen zugewandt hat. Er läßt ja seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten, heißt es kurz vorher, er schenkt Regen den Gerechten und den
Ungerechten (5,45). Das Prinzip des „Ganz“ steht aber nicht nur hinter Mt 5,48.
Es ist der Schlüssel zu vielen anderen Sätzen der Bergpredigt. In 6,24 wird der Ausschließlichkeitsanspruch Gottes aus dem Alten Testament unmittelbar aufgegriffen: Keiner kann zwei Herren dienen. Entweder haßt er den einen und liebt den anderen, oder er hängt an dem einen und den anderen missachtet er. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon (Mt 6,24). Auch hier ist alles ganz eindeutig: Für den Schüler der Bergpredigt darf es nur ungeteilten Dienst vor Gott geben. Macht er neben Gott zugleich den Mammon, das heißt den eigenen Besitz, zu seinem Herrn, lebt er bereits gespalten und geteilt. So wie der Text formuliert ist, setzt er voraus, dass dieses Gespaltensein gerade das Problem des von Gott
angerührten Menschen ist. Der Böse will sowieso nur sich selbst dienen. Insofern lebt er
oft sogar „ganzheitlicher“ als der Gute. Der Gläubige aber will beides: Er möchte durchaus Gott dienen – und doch auch seinen eigenen Interessen leben. Die Bergpredigt sagt mit größter Nüchternheit: Beides zusammen geht nicht. Wenn man im Angesicht Gottes
leben will, kann man es nur ganz und ungeteilt tun. Bei diesem „Ganz“ geht es nicht
nur um das Geld. Der Nachfolger Jesu lebt auch geteilt, wenn er seine Mitmenschen einteilt in solche, die man lieben muß, und in solche, die man hassen darf (5,43-47). Er lebt geteilt, wenn er bei seinen Urteilen mit zweierlei Maß misst: Wenn er den Splitter im Auge des anderen sieht und den Balken im eigenen Auge gar nicht bemerkt (7,3-5). Er lebt geteilt, wenn er Gott im Gebet als seinen Vater anruft, sich aber zugleich in ständiger Angst um sein Leben und um die Bedürfnisse seines Lebens verzehrt (6,25-34). Er lebt geteilt, wenn er zwar im Gottesdienst „Herr, Herr!“ sagt, aber das Gesetz mißachtet. Dann hilft ihm nicht einmal, wenn er als Prophet auftritt oder im Namen Gottes Außerordentliches vollbringt. Er bleibt ein „Übertreter der Tora“ (7,21-23). Er lebt auch geteilt, wenn er seine Frömmigkeit, seine guten Werke, seine Gebete und sein Fasten öffentlich zur Schau stellt, weil er damit zeigt, dass es ihm vor allem auf die Anerkennung durch Menschen ankommt. Auf die Anerkennung durch Gott will er freilich auch nicht verzichten. Er will also doppelten Lohn:
den von Menschen und den von Gott, und eben das macht sein Tun zwiespältig (6,1-18).
Gespalten und geteilt wäre der Jünger aber auch, wenn er seinen Glaubensgenossen zwar nicht umbrächte, ihn aber hassen würde (5,21f), oder er den realen Ehebruch zwar scheute, ihn aber in seiner Phantasie genussvoll beginge (5,27f). Der erschreckende Satz, dass schon der begehrliche Blick auf die fremde Frau Ehebruch sei, wendet sich gegen eine geteilte und gespaltene Liebe. Was die matthäische Bergpredigt in vielen Einzelsprüchen formuliert, erzählt Markus im Rahmen einer Geschichte. Es ist die Geschichte von dem Opfer der armen Witwe: Jesus hatte sich (im Tempel) gegenüber der Schatzkammer hingesetzt und sah zu, wie die Leute Geld in die Schatzkammer brachten. Viele Reiche brachten viel. Und es kam eine arme Witwe und brachte zwei Lepta, das ist ein Quadrans.
Da rief Jesus seine Jünger herbei und sprach zu ihnen:
„Wahrhaftig, ich sage euch: Diese arme Witwehat mehr gegeben als alle anderen, die Geld in die Schatzkammer gebracht haben. Denn alle haben sie nur aus ihrem Überfluss gegeben. Diese Frau aber hat aus ihrem Mangel gegeben: alles, was sie besaß, ihren ganzen
Lebensunterhalt (Mk 12,41-44).
Kurz zuvor war Jesus von einem Schriftgelehrten nach dem wichtigsten Gebot gefragt
worden. Er hatte als Antwort das Hauptgebot Dtn 6,4f und das Gebot der Nächstenliebe aus Lev 19,18 zitiert – und zwar das Hauptgebot in der folgenden Form:
Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem g a n z e n Herzen, deiner g a n z e n
Seele, deinem g a n z e n Verstand und mit deiner g a n z e n Kraft (Mk 12,30).
Für Markus ist das Opfer der Witwe eine Veranschaulichung des Hauptgebots. Die Witwe, sagt die Erzählung in bestürzender Deutlichkeit, gab nicht nach der Art, wie man Spenden oder Almosen gibt. Sie gab nicht einmal den Zehnten oder die Hälfte. Sie gab alles.
Sie hat alles gegeben und damit sich selbst… Hat sie das Hauptgebot wirklich mit ihrem ganzen Verstand befolgt? Wenn diejenigen, die versuchen, die Geschichte von der armen Witwe zu leben, an ihr scheitern müssten, wäre diese Geschichte in sich unsinnig, mehr noch, sie wäre verantwortungslos und dürfte nicht in der Bibel stehen.
Die Geschichte setzt, wie alle biblischen Texte, den Boden des Volkes Gottes voraus.
Markus muß, wenn er diese Geschichte erzählt, das konkrete Miteinander in christlichen Gemeinden vor Augen gehabt haben. Dort, wo viele ihr Leben in solcher Weise verknüpfen, ist die Witwe nicht mehr allein. Dort gibt es immer Schwestern und Brüder, die ihr Schutz geben und mit ihr das Mahl teilen. Dort wird sie dann aber auch gebraucht. Nicht nur ihr wird geholfen, sondern sie selbst kann anderen helfen. Wir wissen aus der jüdischen und frühchristlichen Literatur, dass die Sorge für die Witwen etwas den Gemeinden Wichtiges, ja Wesentliches war. Wir wissen darüber hinaus, welch entscheidende Rolle die Witwen und Ehelosen in der frühen Kirche für den Aufbau der Gemeinden spielten. Sie halfen nicht nur mit dem, was sie hatten, sie waren auch Realsymbol für das „Ganz“. Schon anlässlich eines anderen Markustextes, nämlich der Erzählung von der ´wunderbaren Brotvermehrung´, war davon die Rede gewesen, dass Spenden und caritative Hilfsaktionen – so nötig sie sind – die Not der Welt nicht wirklich wenden können. Die Weltgeschichte reproduziert ihre Elendsstrukturen unaufhörlich von neuem. Wir sahen schon dort: Die Lösung muss tiefer ansetzen. Jesus lässt die Jünger nicht weggehen, um Brot zu besorgen, sondern er ordnet die Hungernden zu Mahlgemeinschaften…
Das Wunder der Brotvermehrung setzt sich fort in Gemeinden, in denen jeder alles gibt, was er hat: sein Vermögen, seine Zeit, seine Arbeitskraft – aber auch sein Unvermögen,
seine Schwächen und seine anscheinend leeren Hände, in denen nur die Lächerlichkeit von zwei Kupfermünzen ist (Geschichte von der armen Witwe, Mk 12,41-44)…Diese Lösung Gottes für die Not der Welt ist die vernünftigste und sachgerechteste Lösung, die es gibt.
Wer seine Hand an den Pflug legt
Gib Gott 100 Prozent (1) – Joyce Meyer
Gerechtigkeit und die Werke der Barmherzigkeit
Gerhard Lohfink: Gelebte Gemeinschaft Wir können Jesus nicht alleine nachfolgen.
Gerhard Lohfink, katholischer Priester, Theologe, Autor, Mitarbeiter und Freund von Plough, starb am 2. April 2024. Nach seiner Promotion in Theologie an der Universität Würzberg im Jahr 1971 lehrte Lohfink an der Universität Tübingen. 1987 beschloss er, seine Professur aufzugeben und sich einer Gemeinschaft gleichgesinnter Katholiken, in Bad Tölz, Deutschland, anzuschließen. Einige Jahre danach begann er wieder, theologische Werke zu schreiben. Insgesamt veröffentlichte er 22 Bücher. Kurz vor seinem Tod aufgrund
schwerer Krankheit arbeitete er noch an dem autobiographischen Manuskript,
„Warum ich an Gott glaube“. Ich werde Lohfink immer für seine Freundschaft dankbar
sein. Im Jahr 2019 war ich fünf Monate lang Gast in seiner kleinen Hausgemeinschaft.
Bei unseren täglichen Abendessen sprachen wir über Theologie und das Leben.
Dann spülten wir gemeinsam das Geschirr ab u. setzten das Gespräch fort. Manchmal lud er mich ein, ihn auf seinen langen Spaziergängen zu begleiten oder seine Lieblingskirchen zu besuchen. Als ich im Januar 2024 das letzte Mal mit ihm redete, hatte sich sein Gesundheitszustand deutlich verschlechtert, doch er sprach immer noch mit demselben ruhigen Charisma und Feuer über sein neuestes Buchprojekt. Lohfinks größte Erkenntnis – die sein Leben bestimmte – war, dass man Jesus nur gemeinsam mit anderen nachfolgen kann. Dies kommt in vielen seiner Werke zum Ausdruck. In einem Beitrag für die Plough
Anthologie Called to Community: The Life Jesus Wants for His People, schreibt er:
Der christliche Glaube stellt, genau wie der jüdische, das ganze Leben unter die Verheißung und den Anspruch Gottes. Er ist darauf ausgerichtet, alle Lebensverhältnisse der Glaubenden zu durchdringen und ihnen eine neue Gestalt zu geben. Er drängt von sich aus dazu, gesellschaftliche Verhältnisse zu verändern und den Stoff der Welt zu formen.
Der Glaube will alles einbeziehen, damit „neue Schöpfung“ entstehen kann.
Zugleich tendiert der Glaube zu einem immer intensiveren Miteinander der Gläubigen. Denn nur in der Gemeinde, dem Ort dieses Miteinanders, nur in dem von Gott gestifteten Raum der Erlösung, kann der Stoff der Welt wirklich verwandelt, können gesellschaftliche Verhältnisse wahrhaft verändert werden. Für den christlichen Glauben wäre es deshalb
wesentlich, daß die einzelnen Gläubigen nicht isoliert nebeneinanderher leben, sondern zu einem Leib verbunden sind. Es käme darauf an, daß sie all ihre Begabungen und Möglichkeiten miteinander verflechten, daß sie in ihren Versammlungen ihr ganzes Leben vom Kommen der Gottesherrschaft her beurteilen und sich die Einmütigkeit der agape schenken lassen. Dann würde die Gemeinde zu dem Ort, an dem die messianischen Zeichen,
die dem Gottesvolk versprochen sind, aufleuchten und wirksam werden können.
Von Gerhard Lohfink, Braucht Gott die Kirche? (Herder).
Gerhard Lohfink DAS HEUTE DER GOTTESHERRSCHAFT
Gerhard Lohfink, Braucht Gott die Kirche?
DAS WUNDER DER BROTVERMEHRUNG (Mk 6,35-41)
Als nun der Tag fast vorüber war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen: Es ist öde hier, und der Tag ist fast vorüber; laß sie gehen, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsum gehen und sich Brot kaufen.
Er aber antwortete und sprach zu ihnen: „Gebt ihr ihnen zu essen.“
Damit ist der bequeme Weg, die Gesellschaft nur zu bepredigen und sie im übrigen sich selbst zu überlassen, erledigt. Jesus macht die Aufteilung der Wirklichkeit in verschiedene Bereiche nicht mit. Er verweist seine Jünger mit Nachdruck darauf, dass zum Reich Gottes alles gehört: die ganze Existenz des Menschen, gerade auch das Essen. „Sollen wir gehen, für 200 Denare Brot kaufen und es den Leuten austeilen, damit sie zu essen bekommen?“
Wie exakt hier kalkuliert wird. 200 Denare ergeben 2400 Tagesrationen oder 4800 halbe
Tagesrationen. Das kommt für 5000 Esser knapp hin. Der zweite Lösungsvorschlag der
Jünger von damals ist inzwischen in den Kirchen zum gängigen Modell geworden, Brot für die Welt zu beschaffen. Es ist kein Zufall, dass die Bezeichnungen „Brot für die Welt“ und „Misereor“ gerade dem Textkomplex „Brotvermehrung“ entnommen sind.
Das Bestürzende ist nur: Jesus akzeptiert auch den zweiten Lösungsvorschlag nicht.
Er ist offenbar überzeugt: Auf diesem Weg können die Armen nicht wirklich satt werden. 4800 halbe Tagesrationen für 5000 Esser – damit kann gerade noch der schlimmste Hunger gestillt werden, damit kann man die Menschen bestenfalls abspeisen. Aber Reich Gottes meint doch viel mehr. Es soll nicht nur die Not beseitigen, sondern zu seinem Wesen gehört der Überfluss. Im Reiche Gottes soll göttliche Fülle aufleuchten. Vor allem aber:
Die Aktion wohlorganisierter Hilfe, welche die Jünger vorschlagen, würde ja die Welt gar nicht wirklich verändern. Die Gesellschaft bliebe, was sie ist. Sie würde stets von neuem
ihre Elendsstrukturen produzieren, die Jünger müssten ohne Unterlass keuchend hin -und herlaufen, um Hilfe gegen den Hunger zu organisieren, und sie würden dabei mit dem Elend doch nicht fertig werden. Jesus geht konsequent einen dritten Lösungsweg.
Es ist der Lösungsweg der Gottesherrschaft.
„Wie viele Brote habt ihr dabei?“ Es ist nicht notwendig, die Menschen fortzuschicken, und es ist auch nicht notwendig, ihnen von anderswoher Essen zu organisieren. Das Festmahl der Gottesherrschaft wird sich als Wunder entfalten – und zwar als Wunder aus dem, was schon da ist. Damit sich das Wunder ereignen kann, muss allerdings zuerst noch etwas
Entscheidendes geschehen.
Jesus befiehlt den Jüngern, sie sollten die Massen in „Mahlgemeinschaften“
aufteilen: Und er gebot ihnen, daß sie sich alle lagerten, tischweise, auf das grüne Gras.
„Und die Leute legten sich nieder, Abteilung neben Abteilung, jeweils zu hundert und zu fünfzig“. Das ist eindeutig eine Anspielung auf Ex 18,25. In diesem Text wird die Lagerordnung des durch die Wüste ziehenden Gottesvolkes geschildert. Jesus formiert die Volksscharen, die ziel-und orientierungslos sind, die wie Schafe ohne Hirten umherlaufen zum Gottesvolk der Endzeit. Dann werden sie nicht nur abgespeist, sondern erleben das Fest. Dann bleiben sogar zwölf Körbe voll Brot übrig. Nach Ostern wird sich die Kirche in überschaubarer Form unter endzeitlichem Jubel zu Festmählern versammeln (Apg 2,46), in
denen alle alles miteinander teilen – nicht nur das Brot, sondern die ganze Existenz.
Lukas wagt über diese Kirche den Satz: Es gab keine Armen unter ihnen (Apg 4,34).
Gerechtigkeit und die Werke der Barmherzigkeit
GERHARD LOHFINK, GEGEN DIE VERHARMLOSUNG JESU
Das Magnifikat: Signal für eine Revolution
Lob der Bescheidenheit?
Wenn man das Magnifikat betet, kann man leicht einer Täuschung erliegen. Maria sagt ja in diesem Lied, Gott habe auf ihre „Niedrigkeit” geschaut. Das wurde nicht selten als ein Lob der Kleinheit ausgelegt, als ein Lob der Anspruchslosigkeit, der Existenz im Verborgenen. Preist Maria im Magnifikat die Bescheidenheit und das Sich-Bescheiden? Romano Guardini hat einmal irgendwo gesagt, wir Christen sollten demütig sein, aber nicht bescheiden.
Damit traf er genau den Geist des Magnifikat. Dieses Lied spricht nicht von verdruckster Anspruchslosigkeit, sondern davon, dass Gott den Unterdrückten zu ihrem Recht verhilft und die Unterdrücker von ihren Thronen stößt. Das Magnifikat tröstet nicht über das Elend dieser Erde hinweg. Es spricht vielmehr von der Umkehrung aller Verhältnisse – jetzt, heute. Es spricht von Revolution und Umsturz. Der Ort dieser stillen Revolution, von der Maria singt, ist Israel, ist die Kirche, sind unsere Gemeinden. Oder sagen wir vorsichtiger: Sie sollten es sein – jedenfalls wenn sie das Magnifikat beten und dabei nicht
nur leere Worte machen. Unsere Gemeinden sind der Ort, wo Menschen in Gewaltlosigkeit,
Solidarität und Einmütigkeit zusammenleben und einander immer wieder vergeben sollen. Wenn das wirklich geschieht, findet die Revolution Gottes statt, die unsere Welt verändert.
»Die Revolution wird nicht im Fernsehen übertragen werden!« – Gill Scott Heron

Gerhard Lohfink: Auf der Erde, wo sonst?
Für das Alte Testament ist die Landverheißung fundamental. Das Stichwort „Land“
durchzieht fast alle Bücher der hebräischen Bibel. Gemeint ist damit der reale Boden
Israels, das „Land, wo Milch und Honig fließen“. Wie steht es damit bei Jesus?
Die Landverheißung taucht ja auch bei ihm auf. „Selig, die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben“, sagt er in der dritten Seligpreisung der Bergpredigt (Mt 5,5).
Ist das- im Gegensatz zum Alten Testament – nur noch bildlich gemeint? Rein geistig?
Meint hier das „Land“ am Ende gar den Himmel? Der Schlüssel zum Verstehen dieser
für den christlichen Glauben grundlegenden Frage ist Mk 10,29f. Dort sagt Jesus:
„Es gibt niemanden, der verlassen hat Haus, Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der dafür nicht das Hundertfache
erhielte. Schon jetzt in dieser Zeit: Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker –
wenn auch unter Verfolgungen. In der kommenden Welt aber das ewige Leben.“
In diesem Text werden einander gegenübergestellt: die alte Familie, die die Jünger Jesu verlassen haben – und die neue Familie, welche die Jünger in der Nachfolge gefunden
haben. Die Häuser und Äcker, die von den Jüngern verlassen werden, waren ihr Anteil am Land. Sie gehen ihnen verloren. Aber ihr Anteil am Land der Verheißung geht ihnen nicht verloren (so wenig wie er Barnabas verloren geht Lk4,36f). Ihr „Land“ wird die neue Familie, die Jesus um sich sammelt. In ihr finden sie alles hundertfach wieder, in ihr betreten
sie nun wahrhaft das Land. Auf dem Boden der neuen Familie vollendet sich die Landverheißung. Joh 12,24: „Amen, amen, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht.“
„Der Entschluss, lieber eine Minderheit mit eindeutiger Identität zu bleiben (als die Kirche
zu verweltlichen) ist die Voraussetzung für weltverändernde Wirksamkeit.“ R. Riesner
Entscheidend ist nicht die Größe der Stadt, sondern daß sie auf dem Berge liegt.
Dort wird sie zum Licht der ganzen Welt… Die entscheidende Aufgabe der Kirche ist also, daß sie sich als Kontrastgesellschaft zur Welt aufbaut, als Herrschaftsraum Christi, in welchem die Bruderliebe Lebensgesetz ist. Gerade indem die Kirche das tut, begreift die heidnische Gesellschaft den Plan Gottes mit der Welt. Der Epheserbrief drückt das allerdings wieder mythisch aus: Den Mächten und Gewalten in den himmlischen Bereichen wird dann durch die Kirche die mannigfaltige Weisheit Gottes kundgemacht ( 3. 10). Sagen wir ruhig: Gerade indem die Kirche von Christus her das ist, was sie sein soll, wächst sie von selbst
in die heidnische Gesellschaft hinein, kann Christus durch sie alles erfüllen.
Ist das richtig gesehen, dann haben wir im Epheserbrief in einer völlig anderen Terminologie und vor einem völlig anderen Denkhorizont so etwas ähnliches wie das Modell der Völkerwallfahrt: das Volk Gottes wächst, ohne Mission zu betreiben, durch die Faszination, die es ausstrahlt, in die Gesellschaft hinein. Die Kirche ist dann ganz einfach wirkmächtiges Zeichen für die Gegenwart des Heiles Gottes in der Welt.
Gerade weil die Kirche nicht für sich selbst. sondern ganz und ausschließlich für die Welt da ist, darf sie nicht zur Welt werden, sondern muß ihr eigenes Gesicht behalten. Falls sie ihre Konturen verliert, ihr Licht auslöscht und ihr Salz schal werden läßt, kann sie die übrige Gesellschaft nicht mehr verändern. Dann hilft keine missionarische Aktivität mehr; dann hilft kein noch so betriebsames gesellschaftliches Engagement nach außen hin mehr.
Was die Kirche zur göttlichen Kontrastgesellschaft macht, ist nicht selbsterworbene
Heiligkeit, sind nicht krampfhafte Anstrengungen und moralische Leistungen, sondern die rettende Tat Gottes, der die Gottlosen rechtfertigt, der sich der Gescheiterten annimmt und sich mit den Schuldiggewordenen versöhnt. Erst in dieser geschenkten Versöhnung und im Wunder des gegen alle Erwartung neu gewonnenen Lebens blüht das auf, was hier mit Kontrastgesellschaft bezeichnet wird. Gemeint ist also nicht eine Kirche, in der es keine Schuld mehr gibt, sondern eine Kirche, in der aus erlassener Schuld unendliche Hoffnung wächst. Gemeint ist nicht eine Kirche, in der es keine Spaltungen mehr gibt, sondern eine Kirche, die über alle Gräben hinweg zur Versöhnung findet. Gemeint ist nicht eine Kirche,
in der es keine Konflikte mehr gibt, sondern eine Kirche, in der Konflikte anders ausgetragen werden als in der übrigen Gesellschaft. Gemeint ist schließlich nicht eine Kirche, in der es kein Kreuz und keine Leidensgeschichten mehr gibt, sondern eine Kirche, die immer wieder Ostern feiern kann, weil sie zwar mit Christus stirbt, aber auch mit ihm aufersteht.
Was heißt das – unsere Gemeinden verändern?
Die Kirche muss aufhören, ein Imitat des Staates zu sein. Sie ist allerdings auch mehr
als ein christlicher Verein oder eine religiöse Interessengemeinschaft. Sie ist Gesellschaft
eigener Art. Ihre Gemeinden müssten das „Land“ sein, das Abraham verheißen wurde.
Das ist mir zu allgemein. Was heißt das konkret? Das heißt, dass die Gemeinden nicht nur seelsorglich „verwaltet“ werden, sondern dass sie ein Lebensraum sind, in dem man den Glauben lernen kann, neue Familie, wo jeder „hundert Brüder und Schwestern“ hat (Mk 10,30), wo er im Miteinander von Glaubenden Gottes Handeln erfährt, wo Glaube und Alltag wieder zusammenkommen, wo es die Möglichkeit der Nachfolge für alle gibt, wo die christlichen Feste als wirkliche Feste gefeiert werden. Aber über solche Gemeinden kann man nicht theoretisieren. Hier gilt das biblische Prinzip „Komm und sieh!“ (Joh 1,46)
Ortswechsel
Man müsse wenigstens einmal im Leben eine andere Religion wirklich kennen gelernt
haben, und das sei nur zu erreichen, wenn man zeitweise ganz die andere Religion lebe,
möglichst in einem anderen Land und in einer anderen Kultur. Ein längerer Aufenthalt
etwa in Indien sei in diesem Sinne empfehlenswert.
Schön und gut! Aber wie wäre es, wenn man zuvor einmal probeweise den christlichen Glauben ganz leben würde – dort wo die Kirche lebendig ist, und wenn man dabei selbst vor einem Ortswechsel nicht zurückschreckte?
Gerhard Lohfink: Gottes Taten gehen weiter
Dort, wo Gemeinde lebt, gibt es eine Geschichte mit Gott, die voller Spannung ist und Heimat schenkt. Diese „Herrlichkeit des Herrn“, die das Gottesvolk in der Endzeit verwandelt, ist ganz konkret vorgestellt: Das Land bringt überreiche Frucht hervor (Jesaja 4,2), selbst die Wüste verwandelt sich in fruchtbares Land, die Augen der Blinden werden geöffnet,
die Ohren der Tauben werden aufgetan, die Lahmen können wieder gehen, die Zunge des Stummen jauchzt auf (35,1-6). Für die Auslegung des Weinwunders von Kana (Joh 2,1-12) ist dieser Realismus der prophetischen Hoffnung von größter Wichtigkeit. Denn auch dort zeigt sich die Herrlichkeit des Herrn ganz konkret in der Überfülle des Weins, den Christus zur Hochzeit schenkt. Diese Überfülle arbeitet die Erzählung sorgfältig heraus.
Nicht die für die Aufbewahrung von Wein damals üblichen Tonkrüge werden auf den Befehl Jesu mit Wasser gefüllt, sondern 6 steinerne Gefäße, bestimmt für die rituelle Reinigung – deshalb aus Stein gehauen und deshalb sehr groß. Jedes dieser Gefäße faßte nach der Angabe des Evangelisten 2-3 Metreten, das sind etwa 100 Liter. Insgesamt handelte es sich um rund 500 bis 700 Liter Wein. Der Erzähler liefert aber nicht nur diese detaillierten Maßangaben, er fügt auch noch ausdrücklich hinzu: Sie füllten sie bis obenhin (2,7).
An solchen Einzelheiten zeigt sich das eigentliche Interesse des Erzählers. Er will sagen:
Die Gabe Jesu ist überreich. Da wird nicht eingeschränkt, begrenzt, gegeizt. Alle großen
Gefäße, die sich im Haus finden, sind bis zum Rand gefüllt. Aber nicht genug damit, dass
so die Überfülle des Weins anschaulich herausgestellt wird. Genauso deutlich verweist
die Erzählung auf die Qualität des Weins… Die „Weinregel“ (Guten Wein setzt man doch
am Anfang und nicht am Ende des Festes vor!), hat innerhalb der Erzählung die Funktion,
dezent und unaufdringlich, aber doch eindeutig klarzustellen: Der Wein, der hier ausgeschenkt wird, ist ein guter, ja hervorragender Wein von bester Qualität. Für das richtige
Verständnis der Erzählung ist es nun von besonderer Wichtigkeit, die Überfülle des Weins
und seine ausgezeichnete Qualität mit dem in 2,11 genannten Begriff der Herrlichkeit Christi unmittelbar in Beziehung zu bringen. Die Herrlichkeit Christi bleibt nicht im Übersinnlichen, Innerlichen, rein Geistigen, Transzendenten, sondern sie wird sichtbar, anschaubar, greifbar, ja man kann sie schmecken und kosten. Sie wird so real und konkret und irdisch, wie nach der Auffassung des Jesaja die „Herrlichkeit des Herrn“ im Israel
der Endzeit real und konkret und irdisch werden soll. Es ist kein Zufall, dass Jesaja
immer wieder vom „Sehen“ jener Herrlichkeit spricht (35,2;40,5;60,5;62,2;66,18)
und dass der 4. Evangelist diese Wendung bewusst aufgreift (vgl. 1,14;11,40).
GEGEN DIE VERHARMLOSUNG JESU
Wie kann ein Einzelner die ganze Welt erlösen?
Unsichtbare Erlösung?
Manche erwiderten zum Beispiel auf den Vorwurf, es habe sich doch in der Welt nicht das Geringste geändert: Ja, draußen hat sich tatsächlich nichts geändert. Die Welt ist noch immer voll Krankheit, Elend und Streit. Aber bei denen, die glauben, hat sich innerlich etwas geändert. Im Inneren, im Herzen, ist der Mensch, der glaubt, erlöst. In seiner Seele wohnt Gott. Der Gerechtfertigte ist erfüllt von heiligmachender Gnade. Was sollen wir dazu sagen? Der Begriff der „heiligmachenden Gnade“ darf natürlich nicht in Frage gestellt werden.
Er ist richtig. Er ist sogar biblisch. Aber wo ist diese Gnade? Nur im Einzelnen? Nicht gerade dort, wo zwei oder drei in Seinem Namen versammelt sind (Mt 18,20)? Und wohnt Erlösung nur unsichtbar in der Seele? Meint sie nicht auch die Verhältnisse in der Gesellschaft, den ganzen Bereich des Sozialen, das Recht, die Wirtschaft, unsere Wohnungen, die Dinge, die Welt, in der wir leben? Von dem New Yorker „Stadtneurotiker“ Woody Allen stammt das Bonmot: Dass es eine unsichtbare Welt gibt, ist nicht die Frage. Die Frage ist, wie weit sie von midtown entfernt ist und wie lange sie geöffnet hat. So genau kann es nur ein Jude sagen. Erlösung ist konkret oder sie ist überhaupt nicht. Dasselbe gilt von der Kirche: Eine rein unsichtbare, in die Innerlichkeit verbannte Kirche hätte die Realität der Erlösung verraten. Gegen die Antwort von der Unsichtbarkeit der Erlösung steht die gesamte biblische Tradition. Jesus heilt Kranke, treibt Dämonen aus, speist Hungrige, sammelt Jünger um sich und lebt mit diesen Jüngern als neue Familie. Und er sagt: „Denkt nicht, ich sei gekommen, Gesetz oder Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen“ (Mt 5,17). Jesus will also die Tora nicht abschaffen, sondern sie zur Vollendung bringen. Das Ziel der Tora aber ist gerade, die Welt wiederherzustellen, gerechte Verhältnisse zu schaffen, die widerständige, oft chaotische Welt zur Schönheit der Schöpfung zurückzuführen. Zu sagen, die Erlösung sei schon geschehen, Jesus habe uns bereits erlöst, aber diese Erlösung sei nur innerlich, nur unsichtbar in den Seelen, habe nur im Herzen stattgefunden, ist eine ganz und gar untaugliche Antwort. Sie wird der biblischen Tradition und auch der wahren Tradition der Kirche wegen ihrer Einseitigkeit nicht gerecht.
Erlösung erst im Jenseits?
Ein zweiter untauglicher Versuch, mit dem Einwand der Juden und dem Vorwurf Nietzsches fertig zu werden, läuft folgendermaßen: Die Erlösung, die Jesus erwirkt habe, komme erst nach dem Tod. Die Erde sei der Ort der Prüfung, der Bewährung, der Entscheidung. Erlösung und Befreiung aber gebe es erst im Jenseits. Auch diese Antwort ist untauglich, ja, sie ist dogmatisch falsch. Jesus hat keine Predigten über das Jenseits gehalten, sondern er hat das Reich Gottes ausgerufen. Und von diesem Reich Gottes hat er gesagt:
„Es ist schon in eurer Mitte“ (Lk 17,21). Und: „Wenn ich mit dem Finger Gottes die Dämonen austreibe, ist das Reich Gottes doch schon zu euch gekommen“ (Lk 11,20). Im Übrigen beten wir bei der Kreuzwegandacht nicht: „Durch dein heiliges Kreuz wirst du die Welt erlösen“, sondern: „Durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst.“ Die Erlösung der Welt
geschieht also nicht im Jenseits, obwohl sie erst dort zur Vollendung kommt.
Sie beginnt bereits hier.
Programmierte Erlösung?
Aber wie soll man sich das vorstellen? Wie soll ein Einzelner die ganze Welt erlösen
können? Die Christen haben auf diese Frage stets mit der Bibel zu antworten versucht:
Es war der Wille Gottes, dass der „Sohn“ Mensch wurde, um die Welt durch das Kreuzesopfer zu erlösen. Nun gibt es in der Bibel tatsächlich eine große Zahl von Texten, die in diese Richtung weisen. Schon im Alten Testament ist von dem Gottesknecht Israel die Rede, der leiden muss, damit die Vielen, das heißt die Völker, erlöst werden. Indem die Völker auf
diesen Gottesknecht blicken, sagen sie:
Unsere Krankheiten – er hat sie getragen, und unsere Schmerzen – er hat sie auf sich genommen. […] Er wurde durchbohrt wegen unserer Vergehen, wegen unserer Sünden wurde er zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. (Jes 53,4-5) Schon das Neue Testament deutet diesen Gottesknecht auf Jesus (vgl. Apg 8,30-35). Er repräsentiert und versammelt in seiner Person ganz Israel. Auch Jesus selbst scheint bereits in diese Richtung gedacht zu haben. Das zeigen seine Abendmahlsworte, das könnte auch das folgende Wort zeigen:
Der Menschensohn muss vieles erleiden, er muss von den Ältesten, den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten verworfen und er muss getötet werden. Aber nach drei Tagen wird er auferstehen. (vgl. Mk 8,31) Es gibt noch viele andere biblische Texte, die ähnlich formulieren. Man könnte das alles folgendermaßen missverstehen: Gott hatte einen Erlösungsplan. Er wollte, dass einer für die Sünden der Welt starb, damit die Welt erlöst würde. Er wollte, er plante den Tod seines eigenen Sohnes, damit die Schuld der Menschen auf diese Weise gesühnt würde. Und dann werden die Aussagen gefährlich: Gott wollte ein blutiges Opfer, damit ihm Genugtuung geschehe und er wieder versöhnt sein könne. Deshalb musste das ganze Programm ablaufen. Die hier angedeutete Vorstellung steht hinter vielen frommen Texten, sie begegnet in alten Liedern und sogar auf Andachtsbildern. Scheinbar hat sie die Bibel hinter sich. In Wahrheit ist sie fragwürdig. Sie verzerrt die biblische Botschaft, ja, sie vergiftet das Gottesbild. Denn sie suggeriert einen auf sein Recht pochenden Gott, der ein blutiges Opfer fordert, damit er versöhnt werden kann. Sensiblen Menschen konnte ein derartiger Gott nur als schrecklicher und grausamer Gott erscheinen. Viele Christen flüchteten deshalb zu Maria, der Mutter der Barmherzigkeit.. Wir müssen also aus falschen Vorstellungen herauskommen, die scheinbar biblisch sind, aber in Wahrheit die Bibel nicht hinter sich haben. Deshalb fragen wir jetzt einfach einmal: Wie ist Jesus eigentlich aufgetreten? Womit begann er seine Predigt? Was war die Mitte seiner Verkündigung?
Verkündigung des Todes?
Ist Jesus in Galiläa mit der Botschaft aufgetreten: „Ich bin in die Welt gekommen, um
zu leiden, und so für die Sünden der Welt zu sühnen, folgt mir nach und leidet mit mir“?
Hat er als die Mitte seiner Botschaft verkündet: „Ich bin in die Welt gekommen, weil Gott will, dass ich ein Opfer werde für die Erlösung der Welt. Der Tod am Kreuz ist das höchste Ziel meines Lebens“? Wenn ja, dann wäre das doch wohl Masochismus gewesen, Verherrlichung des Leidens, eine Kultur des Todes. Die Antwort kann nur lauten: Nein, so ist Jesus nicht aufgetreten. Schon von Anfang an wurde seine Verkündigung als „Evangelium“ be-
zeichnet, als Freudenbotschaft. Markus fasst zu Beginn seines Evangeliums die gesamte Botschaft Jesu folgendermaßen zusammen: Die Zeit ist erfüllt. Nahegekommen ist die
Gottesherrschaft. Deshalb: Kehrt um und glaubt an die Freudenbotschaft! (Mk 1,15)
Und als später Johannes der Täufer aus dem Gefängnis Boten zu Jesus schickt und ihn
fragen lässt: Bist du es, der da kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten?
antwortet Jesus: Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote
stehen auf und den Armen wird die Freudenbotschaft verkündet. (Mt 11,2-5) Blinde, Lahme, Aussätzige, Taube und Tote stehen für das Leid und das Elend der Welt. Jesus geht gegen diese Not an. Elend und Leid entsprechen nicht dem, was die Schöpfung sein soll.
Jesus will, dass Gott in der Welt Herr wird und dass so die Schöpfung zu dem wird,
was sie eigentlich sein soll. Das ist der Impetus seiner Botschaft und seines Handelns.
Aber wie wird das möglich? Es wird möglich, weil Jesus seinem himmlischen Vater absolut vertraut. Er weiß aus diesem letzten Vertrauen: Gott will handeln. Er will nichts anderes als das Glück, das Heil, die Befreiung der Welt. Wer sagt: Irgendwann wird Gott handeln, aber nicht heute, lebt im Misstrauen. Gott gibt heute schon sein ganzes Heil. Wir müssen es nur zulassen. Wenn der Mensch sich diesem Heil ganz öffnet, wird Unmögliches möglich.
Dann fängt die Welt an, sich zu verwandeln. Allerdings: Diese Verwandlung der Welt geschieht nicht magisch.Sie geschieht durch die Hingabe Jesu an Israel, dadurch, dass er mit seiner ganzen Existenz für das Gottesvolk lebt. Dieses „für“ realisiert sich in vielerlei Weise.
Vor allem darin, dass Jesus Jünger um sich sammelt. Sie lernen von ihm Vertrauen, Versöhnung, Mitsorge, Wegschauen von sich selbst und Hinschauen auf das Gottesvolk.
Sie sollen sich die Sorge Gottes um die Welt zu eigen machen. Jesus sammelt Menschen um sich, die alles verlassen – nicht aus Pflichtgefühl, sondern aus dem Glück, den Schatz des Reiches Gottes gefunden zu haben -‚ die ihr Leben miteinander verbinden, die sich 77-mal am Tag verzeihen, die einander dienen und die vor dem Tod keine Angst mehr haben. Aber das würde noch nicht reichen. Er braucht über solche Nachfolger hinaus viele andere, die von ihren Häusern aus mithelfen: mit ihrer Freude, mit ihrer Freundschaft, mit der Hilfe, die ihnen möglich ist, selbst wenn diese Hilfe nur ein Becher mit frischem Wasser wäre
(Mt 10,42), Durch Jesus, über seinen Jüngerkreis und die Freunde und Sympathisanten, die auf ihn schauen, soll Israel neu werden, Befreiung und Frieden finden, und über Israel dann die ganze Welt. Das wäre die Lösung. Stellen wir uns vor, Jesus hätte solche Nachfolger gefunden und sie wären immer zahlreicher geworden, Menschen, die alles hergeben und sich ganz zur Verfügung stellen, damit es in Israel immer mehr Orte gibt, an denen Gott Herr
ist – immer mehr Orte, an denen das „Höre, Israel“ und das „Vaterunser“ gelebte Realität
werden. Dann hätte sich Israel verwandelt. Versöhnung und Friede wären eingekehrt.
Dann wäre Jesus nicht am Kreuz gestorben, und Israel wäre zur leuchtenden Stadt auf
dem Berg geworden.
Es kam anders
Wir alle wissen: Leider ist es nicht so gekommen. So ist es nicht gewesen. Es kam alles
ganz anders. Das Markusevangelium schildert, wie Jesus zwar mit seiner Freudenbotschaft beginnt, wie er Jünger sammelt, wie er Kranke heilt, wie er Segen um sich verbreitet – aber es schildert auch, wie er von Anfang an angefeindet wird, wie sich die Gegner formieren, wie er bewusst verleumdet und seine Botschaft verzerrt wird, wie seine Jünger nicht einmütig sind, sondern untereinander um die ersten Plätze streiten. In geradezu beklemmender Weise schildern die Evangelien, wie die Einsamkeit Jesu wächst: Einer aus dem eng-
sten Jüngerkreis verrät ihn, einer verleugnet ihn, und am Ende sind alle geflohen.
Der die Lösung hat für die Not der Welt, soll mundtot gemacht und seine Sache aus der Welt geschafft werden. Der Tod Jesu wird aber nicht nur verursacht durch den Hass seiner Gegner, sondern auch durch die Angst und Feigheit seiner Anhänger und durch die Gleichgültigkeit der Vielen.
Einer allein?
Die Vernichtung Jesu scheint also gelungen. Seine Worte und seine Taten scheinen widerlegt. Doch dann geschieht das Wunder von Ostern und Pfingsten: Die überall hin zerstreuten Jünger sammeln sich wieder. Sie sehen den Auferstandenen. Sie erfahren ihre Versammlung als den Ort der Vergebung. Sie verkünden Jesus als den, der für Israel gestorben ist und der nun zur Rechten Gottes sitzt, das heißt, sie verkünden ihn als den, der im Recht war. Sie erfahren ihre eigene Umkehr und ihre neue, vertiefte Sicht auf Jesus als das Werk Gottes und als österliches Geschenk des Auferstandenen. Sie tun nun genau das, was sie bei Jesus gelernt hatten, vor seinem Tod aber nicht verstanden hatten. Sie ringen um Einmütigkeit untereinander und gründen aus dieser Einmütigkeit heraus immer neue Gemeinden. Auf dem Boden Israels entsteht Kirche. So erweist sich der Tod Jesu nicht als Ende, sondern als neuer Anfang, der in Israel fortführt, was Jesus begonnen hatte. Er war nicht sinnlose Katastrophe, sondern Besiegelung der Hingabe Jesu und der Treue, mit der er
unbeirrt an seinem Auftrag festgehalten hatte. Durch den Tod Jesu und durch seine Auferweckung werden den Jüngern die Augen geöffnet und sie begreifen zum ersten Mal ganz,
was nun ihr Auftrag ist. Der Weg unserer Erlösung beschreibt also einen weiten Bogen.
Dieser Weg begann bereits mit Abraham. Er hat seinen absoluten Höhepunkt in Jesus Christus. Nicht erst in seinem Tod. Sein Tod ist nur die Verendgültigung dessen, was er schon vorher gelebt hat: die völlige Hingabe an seinen Auftrag – da zu sein für Israel und
für die Welt. Jesus hat die Lösung Gottes für die Welt gelebt und so die Erlösung für immer in die Welt eingestiftet. Aber diese von ihm in die Welt eingestiftete Lösung muss nun von der Kirche weltverändernd gelebt werden, damit sie alle Völker und alle Kulturen erreicht. Hat uns also einer allein erlöst? Ja und nein! Jesus war der Einzige, der die Lösung Gottes für die Welt gefunden und sie in letzter und absoluter Hingabe gelebt hat. Insofern sind wir durch ihn allein erlöst. Und doch brauchte es die lange Glaubensgeschichte Israels, damit Jesus überhaupt möglich wurde. Und Jesus braucht ein Volk, damit das, was er gelebt hat, die ganze Welt erreicht. Die Kirche ist das sakramentale Zeichen, welches das der Welt ein für alle Mal eingestiftete Heil Jesu Christi sichtbar macht und vermittelt.
Sowohl als auch
In diesem Sinn dürfen wir die Fragen, die sich für uns ergeben hatten, ergänzen, damit unser einseitiges Verstehen differenziert wird, damit es vollständig wird, damit es das Ganze umfasst, also katholisch wird. Denn das griechische Wort kath‘ holon – katholisch – sagt: „das Ganze enthaltend“, „bezogen auf das Ganze“. Erlösung im biblischen Sinn umfasst
jeweils beides: die Welt des Sichtbaren und des Unsichtbaren; das Diesseits und das Jenseits; das Heute und das Kommende; unsere Freiheitsgeschichte und den ewigen Plan Gottes; die Verkündigung der Leben schenkenden Gottesherrschaft und die Verkündigung des Todes Jesu; die Tatsache, dass Jesus allein uns erlöst hat und dass er doch viele braucht, damit diese Erlösung die ganze Welt erreicht. Von diesem Gesamtbild her müssen wir nun die großen alten Begriffe der christlichen Tradition zu verstehen suchen. Sie sind ohne Ausnahme sachgerecht und notwendig. Aber sie müssen richtig ausgelegt werden – aus dem Gesamt des biblischen Denkens heraus. Sie dürfen nicht fundamentalistisch verzerrt werden. Sie dürfen aber auch nicht verbilligt und verharmlost werden. Erst recht dürfen sie nicht verschwiegen oder gar beseitigt werden.
Stellvertretung
Blicken wir zunächst auf den Begriff der Stellvertretung. Die christliche Tradition sagt,
Jesus habe stellvertretend für uns sein Leiden auf sich genommen und sei stellvertretend für uns gestorben. Gerade an dieser Aussage scheiden sich seit der europäischen Aufklärung die Geister. Wie kann ein Anderer etwas für mich tun, das ich selbst tun müsste?
Wie kann ich mich von einem Anderen erlösen lassen? Muss ich mich nicht selbst erlösen?
Der autonome Mensch ärgert sich maßlos, wenn er gesagt bekommt: „Du selbst kannst es nicht.“ Deshalb hat Immanuel Kant in Opposition gegen alle Stellvertretungstheologie insinuiert: „Du kannst, denn du sollst.“ Aber selbst ein so großer Philosoph hat offenbar wenig über den Menschen gewusst. Wir sind vom Anfang bis zum Ende unseres Lebens auf andere angewiesen. Als Kinder brauchten wir unsere Eltern, die uns zu essen gaben, die uns anzogen, die uns aufs Töpfchen gesetzt, uns die Nase geputzt und uns die Schuhe zugebunden haben – bis wir es endlich selbst konnten. Dann brauchten wir Lehrer, die uns mit unendlicher Geduld Rechnen und Schreiben beigebracht haben. Und dass andere uns geholfen haben, uns in neue Bereiche eingeführt haben, uns mit ihrem Können vorangegangen sind, uns Lösungen gezeigt haben – das ging doch immer weiter. Wir sind auch als Erwachsene unablässig auf die Kompetenz und die Hilfe anderer angewiesen. Und wenn wir alt geworden sind, brauchen wir erst recht die Fürsorge der Anderen, das Gespräch mit Verwandten und Freunden, oft sogar das Gedächtnis unserer Umgebung, wenn unser eigenes Gedächtnis immer schwächer wird. Noch einmal anders: Wenn ich mit dem Auto über eine hohe Brücke fahre, vertraue ich der Kompetenz der Statiker, die diese Brücke konstruiert haben, und der Sorgfalt der Techniker, die sie Jahr für Jahr warten. Jeder Mensch, jede Gesellschaft lebt von unendlich vielen Stellvertretern. Erst recht lebt die Kirche vom Glauben ihrer Heiligen, und zuerst und vor allem von dem Weg, den Jesus gegangen ist.
Die These Immanuel Kants „Du kannst, denn du sollst“ ist grundfalsch. Sie müsste heißen:
Du kannst, wenn du willst, dass dir geholfen wird. Dabei hat Stellvertretung niemals den Sinn, den Anderen von seinem eigenen Tun, von seinem eigenen Glauben und seiner
eigenen Umkehr zu dispensieren. Stellvertretung will gerade das eigene Tun ermöglichen.
Wahre Stellvertretung entmündigt nicht, sondern will nichts lieber, als dass der Andere frei wird, selbst zu handeln. Genau so dürfen wir nun auch die Stellvertretung Jesu verstehen: Er hat die Lösung gefunden – aufbauend auf der langen Erfahrungsgeschichte Israels – und hat sie bis in den Tod als Dasein für die Anderen gelebt. Ich habe die Lösung nicht selbst
gefunden. Aber ich darf in Freiheit in sie eintreten. Ich könnte sie aus eigener Kraft – allein und auf mich gestellt – niemals leben. Aber ich kann aufgrund dessen, was Jesus der Welt eingestiftet hat, mit vielen Anderen zusammen in diese Lösung eintreten.
Das meint das für den heutigen Menschen so unverständlich gewordene Wort „Stellvertretung“. Vielleicht kann uns auch noch der folgende Gedankengang weiterhelfen: Dass eine solidarische Gesellschaft, in der jeder für die Anderen da ist, die beste aller Gesellschaften wäre, leuchtet unmittelbar ein. Man stelle sich nur vor: Jeder tritt für den Anderen ein, jeder trägt des Anderen Last. Die schlechthin ideale Gesellschaft! Das neu gewonnene Paradies! Nur kann es leider auf dem Weg der bloßen Einsicht nie zu solcher Gesellschaft kommen: Sie könnte ja nur funktionieren, wenn alle solidarisch wären. Trage ich selbst der Anderen Last, ohne dass sie meine eigene Last mittragen, schneide ich schlechter ab als die Anderen. Ich werde schamlos ausgenutzt, ich habe keine Zeit mehr für mich selbst, ich werde zerrieben. Also fange ich erst gar nicht an. Die solidarische Gesellschaft hat deshalb nur dann eine Chance, wenn einer ohne Angst, er käme zu kurz, anfängt, für die Anderen
zu leben, und: wenn er viele Nachfolger findet. Aber einer muss anfangen: mit seiner ganzen Zeit, mit seiner ganzen Kraft, mit seinem ganzen Vermögen, mit seiner ganzen Existenz.
Genau das meint die Bibel mit Stellvertretung. Der EINE hat angefangen und alles hergegeben. Nicht aus Askese, nicht aus Masochismus, nicht aus Lust am Leiden und an Opfern, sondern aus der Freude an dem gefundenen Schatz (Mt 13,44), aus der Lust an Gott und seiner Sache. Weil es ihn gab, weil es seine Freude und seine Hingabe gab, ist Kirche als
Ort seiner bleibenden Gegenwart möglich geworden und damit auch unsere Freude und
Hingabe.
Opfer
Damit sind wir bereits beim Opferbegriff. Auch da gilt es, zunächst einmal zu sehen, dass kein Mensch ohne die „Opfer“ anderer leben kann. Ganz schlicht: Was haben andere Menschen an Zeit und Kraft für mich eingesetzt, damit ich überhaupt ein halbwegs vernünftiger Mensch werden konnte! Gerade heutige Eltern erfahren nicht nur das Glück, das Kinder
bedeuten können, sondern auch und oft noch mehr die Überforderung, die im 21. Jahrhundert das Aufziehen von Kindern mit sich bringt. Für viele Eltern ist es ein Kraftakt,
Kinder zu haben. Sie sind erschöpft, beklagen den Wegfall aller Rückzugsmöglichkeiten, können Beruf und Familie kaum vereinbaren, wollen oft nur noch überleben. Allein die
Tatsache, dass man in der Großstadt sein Kind eben nicht mehr einfach zum Spielen auf die Straße schicken kann, zeigt die Belastungen heutiger Eltern. Doch im Grunde ist es früher nicht viel anders gewesen. Damals waren es grassierende Krankheiten, die vielen Kindern das Leben nahmen und die Eltern mit Schmerz erfüllten. Kinder in die Welt zu setzen, war neben aller Freude schon immer mit Opfern verbunden. Wir alle leben davon, dass
unsere Eltern diese Opfer nicht gescheut haben. Wer sich ein Leben ohne Opfer ersehnt,
ist absolut realitätsblind. Aber vielleicht sagen wir statt Opfer lieber Zuneigung und Hingabe, dann wird deutlicher, dass es um etwas geht, ohne das kein Mensch existieren kann.
Im Übrigen ist jede wahrhafte Liebe mit Opfern verbunden. Denn ich darf den Anderen nicht zurechtbiegen, nicht mir anverwandeln, nicht nach meinem Bild formen wollen.
Benedikt XVI. schreibt in seiner Enzyklika „Spe salvi“ vom 30. November 2007:
Und endlich ist auch das Ja zur Liebe Quell von Leid, denn Liebe verlangt immer wieder Selbstenteignungen, in denen ich mich beschneiden und verwunden lasse; sie kann gar
nicht ohne dieses auch schmerzliche Aufgeben meiner selbst bestehen, sonst wird sie zu reinem Egoismus und hebt sich damit als Liebe selber auf (Nr. 38) Wenn wir vom Kreuzesopfer Jesu Christi reden, so heißt das deshalb, dass er mit einer letzten Hingabe nicht für sich selbst da sein wollte, sondern für Gott und für die Menschen. Wir müssen uns beim Begriff des Opfers Christi freimachen von den Opfern in den Religionen. Da konnte es zwar auch um Hingabe an das Heilige, um Hingabe an das absolut Andere gehen, ja sogar um Verehrung und Anbetung. Wir dürfen das nicht ausschließen. Aber aufs Ganze gesehen bieten die heidnischen Opfer doch ein anderes Bild. Da sollen unsichtbare Kräfte beeinflusst werden; da sollen schädliche Einflüsse neutralisiert werden; da sollen gefährliche Mächte besänftigt werden. Das alles war sehr konkret: Die Götter rochen den Bratenduft der Stiere und Schafe und wurden milde gestimmt. Oder man zog Sackkleider an, schmierte sich Asche ins Gesicht, fügte sich blutende Wunden zu und glaubte so, die Götter umzustimmen.
Oder man opferte das Liebste, das man hatte, etwa das eigene Kind, um die Götter zu versöhnen und die Stadt vor ihren Feinden zu retten. Oder man machte eine Wallfahrt mit Steinen in den Schuhen und rutschte das letzte Stück auf den Knien, um von Gott zu erreichen, was man für sich selbst wollte. All diese Arten von Opfern liefen in Gefahr, vor dem
jeweiligen Gott Leistungen zu erbringen, damit er die menschlichen Interessen erfüllte.
Opfer im biblischen Sinn meint etwas anderes: Es meint Hingabe. Es meint ein Hören mit der ganzen Existenz auf das, was Gott will. Es geht dann nicht mehr um die eigene Sache,
sondern um die Sache Gottes.
Sühne
Entsprechend meint auch Sühne im biblischen Sinn etwas anderes als Sühne in den Religionen. Biblische Sühne hat ihren Ausgangspunkt darin, dass der Mensch Unheil geschaffen hat – in sich selbst und um sich herum. Dieses selbstgeschaffene Unheil breitet sich aus, es gebiert neues Unheil, es zerstört Leben, es schafft sich fortzeugend Tod. Da bietet Gott neues Leben an, einen neuen Anfang. Aber nicht in Form einer Himmelsstimme, die sagt: „Eiapopeia, es war ja gar nicht so schlimm“, oder: „Jetzt sind wieder alle lieb zueinander, dann ist alles o.k.“ Es ist ja gar nicht alles wieder gut. Was der Mensch angerichtet hat, ist verheerend und es hat verheerende Folgen, die sich potenzieren können. Sühne im biblischen Sinn heißt gerade, dass Gott in dieser Situation Sühne schenkt. Er selbst gewährt Sühne, das heißt, er selbst stiftet einen Neuanfang, damit der Mensch aus seiner heillosen Verstrickung herauskommen kann. Gott schenkt neues Leben. Der Mensch muss es sich nicht erst verdienen. Das ist in der Bibel mit Sühne gemeint. Und in diesem Sinn hat Gott den Tod Jesu, den er in keiner Weise gewollt hat, sondern den wir Menschen verursacht haben, zu einem alles umstürzenden Neuanfang gemacht. Wenn wir an dieser Stelle einen Blick auf die Theologie des Aristoteles werfen, lässt sich das Gesagte noch ein Stück weit vertiefen. Für Aristoteles ist Gott unendlich vollkommener Geist, der von Ewigkeit her aus sich selbst und durch sich selbst existiert. Er ist reiner Geist, reines Denken.
„Aber was denkt er eigentlich?“, fragt Aristoteles im 12. Buch seiner „Metaphysik“ (1074 b) und antwortet: Er denkt sich selbst, denn er selbst ist ja das Höchste und Beste, das es überhaupt gibt. Was könnte er – in der Logik des Aristoteles – auch sonst denken? Er ist ja vollkommenes Bei-sich-selbst-Sein. Wenn er etwas anderes denken würde als sich selbst, etwa den Menschen oder irgendwelche Einzeldinge, würde er nicht mehr das Höchste denken, sich also von sich selbst wegbewegen und seine Vollkommenheit verlieren. Die christliche Theologie hat sich der griechischen Philosophie dankbar bedient. Sie hat Gott in den Begriffen des Aristoteles gedacht. Und doch ist sie weit über Aristoteles hinausgegangen.
Sie hat von Anfang an gewusst: Gott ist nicht nur Selbstbesitz, sondern Selbsthingabe, so dass Jesus sagen kann: Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. (Mt 11,27)
Die Selbsthingabe des Vaters setzt sich fort in der Selbsthingabe des Sohnes und in dem Sich-Verströmen des Heiligen Geistes. Gott besitzt also gerade darin sich selbst und denkt gerade darin sich selbst, dass er sich hingibt. Aus seiner Liebe heraus, in seiner Hingabe an den Sohn und den Heiligen Geist, denkt er die Welt und ruft sie ins Dasein, damit sie Anteil habe an seinem unendlichen Leben. Von hier aus, von dieser trinitarischen Urbewegung her, muss Erlösung letztlich gedacht werden. Jesu Tod ist zwar nicht von Gott gewollt.
Menschen haben ihn verursacht. Die Gegner Jesu wollten einen, der ihnen zutiefst verhasst war, beseitigen. Jesus aber ist bei seiner absoluten Hingabe an sein Volk und damit an die Welt geblieben und hat gerade so die Hingabe Gottes an die Welt einer gottfeindlichen Welt eingestiftet.
Ein fast unausweichlicher Tod
Stellen wir zum Schluss noch einmal die Frage: Wie konnte uns der Tod Jesu, wie konnte uns der Tod eines Einzelnen erlösen? Die Antwort: Weil er die Lösung gefunden hat, die
Lösung der Gottesherrschaft, die Lösung des neuen Miteinanders, in dem einer für den
anderen da ist. Er hat sie nicht nur gefunden, er hat sie gelebt. Er hat sie nicht nur gelebt,
er ist für diese Lösung gestorben und hat so seine Hingabe für die Anderen in eine letzte
Eindeutigkeit gebracht. Um es immer wieder zu sagen: Diesen Tod hat Gott nicht gewollt.
Menschen haben ihn verursacht. Allerdings war dieser Tod fast unausweichlich.
Denn der Mensch will nicht, was Gott will. Der Mensch will sich selbst. Wenn einer ganz im Namen Gottes redet und handelt und nichts für sich selbst will, sondern nur das, was Gott will, wird er gehasst. Platon, der große griechische Philosoph, hat etwa 400 Jahre vor Christus in seinem Werk über den „Staat“ fast prophetisch gesagt: Der vollkommene Gerechte,
der nicht nur gerecht scheinen, sondern gerecht sein will, würde, wenn es ihn je gäbe, gegeißelt, gefoltert und gefesselt. Die Augen würden ihm ausgebrannt, und nach all diesen
Misshandlungen würde er gekreuzigt (Politeia 361e-362a). Insofern bekommt das „Musste nicht der Messias dies alles erleiden?“ (Lk 24,26) noch einmal einen tieferen Sinn.
Die Bibel spricht immer wieder von diesem „Muss“. Wir werden es jetzt nicht mehr so verstehen, dass Jesus sterben musste, weil Gott es so programmiert hatte, sondern dass er sterben musste, weil er auf erbitterten Hass gestoßen ist. Der Mensch will nicht, was Gott will, sondern er will sich selbst. Das ist der tiefste Grund für den Tod Jesu, und insofern war sein Tod unausweichlich. Gott aber hat gerade aus dieser Katastrophe Israels und der Welt Heil geschaffen, Heil bis in die Wurzel der Welt, weil da Einer war, der Gott ganz verstanden hatte und der ganz für ihn und für die Welt lebte und starb. Ich schließe mit einem Text von Günther Krasnitzky. Er war Mitglied der Katholischen Integrierten Gemeinde und Pfarrer in dem oberbayerischen Dorf Walchensee: Dass einer ungerecht verurteilt und brutal hingerichtet wurde, kam schon öfters vor. Unrecht und Grausamkeit sind nichts Einmaliges.
Einmalig aber war, dass du, Gott, einen Menschen gefunden hast, der deinen Weg ganz erkannte, der nichts für sich zurückbehielt, der eins wurde mit deinem Willen und alles dafür hergab, dein Volk zu sammeln und hinzuführen zur befreienden Erkenntnis deines Willens.
So bist du ans Ziel gekommen mit deiner Schöpfung. Und seitdem feiern wir Ostern als Fest der Vollendung, weil in Jesu Leben und Sterben die neue Schöpfung schon begonnen hat.
Jetzt ist es uns in die Hände gelegt, das Werk, das du in ihm begonnen hast, weiterzuführen.
Denn dass er mit dem, was er tat, die Lösung ist, wird keiner glauben, wenn seine Lösung nicht heute sichtbar und greifbar wird – mitten unter uns.
Das Magnifikat: Signal für eine Revolution
Lob der Bescheidenheit?
Wenn man das Magnifikat betet, kann man leicht einer Täuschung erliegen. Maria sagt ja in diesem Lied, Gott habe auf ihre „Niedrigkeit“ geschaut. Das wurde nicht selten als ein Lob der Kleinheit ausgelegt, als ein Lob der Anspruchslosigkeit, der Existenz im Verborgenen. Preist Maria im Magnifikat die Bescheidenheit und das Sich-Bescheiden?
Romano Guardini hat einmal irgendwo gesagt, wir Christen sollten demütig sein, aber nicht bescheiden. Damit traf er genau den Geist des Magnifikat. Dieses Lied spricht nicht von verdruckster Anspruchslosigkeit, sondern davon, dass Gott den Unterdrückten zu ihrem Recht verhilft und die Unterdrücker von ihren Thronen stößt. Das Magnifikat tröstet nicht über das Elend dieser Erde hinweg. Es spricht vielmehr von der Umkehrung aller Verhältnisse – jetzt, heute. Es spricht von Revolution und Umsturz. Der Ort dieser stillen Revolution, von der Maria singt, ist Israel, ist die Kirche, sind unsere Gemeinden. Oder sagen wir vorsichtiger: Sie sollten es sein – jedenfalls wenn sie das Magnifikat beten und dabei nicht nur leere Worte machen. Unsere Gemeinden sind der Ort, wo Menschen in Gewaltlosigkeit, Solidarität und Einmütigkeit zusammenleben und einander immer wieder vergeben sollen. Wenn das wirklich geschieht, findet die Revolution Gottes statt, die unsere Welt
verändert.
Beten als Realitätsgewinn
Greift Gott in die Welt ein? Bewirkt mein Gebet, dass er handelt? Oder handelt er nur auf die Weise, dass mich mein eigenes Gebet verändert? Es gibt wohl keinen, der die angebliche Sinnlosigkeit des Bittgebets anschaulicher und drastischer ausgemalt hat, als Bert Brecht. Im 11. Bild des Lehrstücks „Mutter Courage und ihre Kinder“ will Brecht den Christen zeigen: Eure Beterei ist völlig sinnlos. Mehr noch: Eure Beterei ist gefährlich. Denn wer betet, wird genau dann, wenn er selbst handeln müsste, durch sein Beten am Handeln gehindert. Beten bringt keinen Realitätsgewinn, sondern Realitätsverlust. Wie versucht Bert Brecht das zu zeigen? Wir befinden uns im Dreißigjährigen Krieg. Im 11. Bild der „Mutter Courage“ nähern sich kaiserliche Truppen tief in der Nacht der Stadt Halle. Soldaten wollen in einem Gehöft vor der Stadt eine Gruppe von Bauern dazu zwingen, dass sie den
Kaiserlichen einen heimlichen Weg in die Stadt zeigen. Die Bauern bringen nichts anderes
fertig, als zu jammern und zu beten:
Vater unser, der du bist im Himmel, hör unser Gebet, lass die Stadt nicht umkommen mit alle, wo drinnen sind und schlummern und ahnen nix. Erweck sie, dass sie aufstehn und gehn auf die Mauern und sehn, wie sie [die Kaiserlichen] auf sie kommen mit Spießen und Kanonen in der Nacht über die Wiesen. […]
Mach, dass der Wächter nicht schläft, sondern aufwacht, sonst ist es zu spät. Unserm Schwager steh auch bei, er ist drin mit seine vier Kinder, lass die nicht umkommen, sie sind unschuldig und wissen von nix. […]
Vater unser, hör uns, denn nur du kannst helfen, wir möchten zugrund gehen, warum, wir sind schwach und haben keine Spieß und nix und können uns nix traun und sind in deiner Hand mit unserm Vieh und dem ganzen Hof, und so auch die Stadt, sie ist auch in deiner Hand, und der Feind ist vor den Mauern mit großer Macht.
Soweit das Gebet der Bauern. Es ist natürlich eine gekonnte Persiflage vieler christlicher Gebete: „Mach, dass der Wächter nicht schläft …“ „Mach, dass meinem Kind nichts passiert ist …“ Wer von uns hat nicht schon ähnlich gebetet? Aber warum sollte man so nicht beten dürfen? Es ist ein Gebet voll Vertrauen in die Allmacht Gottes. Und was passiert bei Brecht? Während die Bauern in dieser Weise beten, packt sich Kattrin, die stumme und verkrüppelte Tochter der Mutter Courage, eine Trommel, steigt auf das Dach des Stalls, zieht die Leiter zu sich herauf und fängt an zu trommeln. Die Soldaten können nicht auf das Dach. Deshalb schießen sie das Mädchen vom Dach herunter. In der Stadt aber hat man ihr Trommeln gehört und schlägt Alarm. Kattrin ist tot, die Stadt wird gerettet. Nicht beten, sondern handeln! Das ist das aufrührerische Fazit dieses 11. Bildes. Beten ist Flucht vor der Realität und Flucht vor der Eigenverantwortung. Bert Brecht hat diese Parole äußerst eindrucksvoll in Szene gesetzt. Allerdings kommt ihm gar nicht in den Sinn, dass Gott durch Kattrin gehandelt haben könnte. Nimmt man Bert Brecht nämlich beim Wort, so wurde Kattrin gerade durch das Beten ihrer Mutter und der Bauern zum Handeln getrieben. Ich bin überzeugt, man könnte anhand dieser Szene von Bert Brecht eine ganze Theologie des Handelns Gottes in der Welt entwerfen. Gott handelt eben nicht so, dass wir es vorauskalkulieren können. Er ist kein Automat, in den man seine Bitte hineinwirft, auf den Knopf drückt und unten kommt die Hilfe heraus – genau in der Form, in welcher der Automat programmiert ist. Gott erhört all unsere Gebete – oft in einer fast erschreckenden Direktheit, oft aber auch diametral anders, als wir es uns ausgedacht hatten. Das Gebet der Bauern wurde ja erhört – aber auf einem anderen Weg, als sie es sich vorstellten. Dieser Weg ging sogar über ein schreckliches Opfer – über den Tod eines unschuldigen Mädchens. Und auch das führt in das Zentrum des christlichen Glaubens. Denn der Welt zu Hilfe kommen, die Welt verändern, geht in den allermeisten Fällen nicht ohne Opfer, weil die Welt zutiefst widerständig ist. Wahre Rettung und wahre Hilfe brauchen meistens das Opfer. Erlösung geschieht nicht magisch. Ich meine, dass Bert Brecht in dieser so bewegenden Szene aus der „Mutter Courage“ – ohne es selbst zu wollen – etwas vom Geheimnis des Eingreifens Gottes in der Welt gezeigt hat. Gott greift ein, aber meist auf ganz anderen Wegen, als wir es uns ausrechnen. Es gibt im Leben vieler Christen die überwältigende, oft geradezu erschreckende Erfahrung, wie genau und wie überreich Gott Gebete erhört. Diese Erfahrung steht in sich.
Mit ihr lässt sich nicht argumentieren, sie lässt sich nicht experimentell überprüfen, erst recht lässt sie sich nicht vermarkten. Sie kann nur immer neu von Einzelnen, von christlichen Gemeinschaften oder von der ganzen Kirche gemacht werden. Daneben aber steht – genauso erschreckend – die Erfahrung, dass Gott schweigt, dass er offenbar nicht eingreift, ja dass er scheinbar das Gegenteil des Erbetenen tut. Beide Erfahrungen können nicht gegeneinander ausgespielt werden, und derjenige, der sie beide immer wieder gemacht hat, kommt auch gar nicht auf den Gedanken, es zu tun. Denn er hat zu oft erfahren, dass Gott trotz seines Schweigens gegenwärtig ist, dass er Gebete nicht erhört und sie in anderer Weise doch erhört, dass schon der Vorgang des Bittgebets selbst zur befreienden,
sinnstiftenden Veränderung der Realität werden kann.
Das Flehen des Aussätzigen von Gerhard Lohfink
Und es kommt zu Jesus ein Aussätziger, fleht ihn kniefällig an und sagt zu ihm: „Wenn du willst, kannst du mich rein machen.“ Und erregt streckt Jesus seine Hand aus, rührt ihn an und sagt zu ihm: „Ich will: Werde rein!“ Und sofort wich von ihm der Aussatz, und er wurde rein. (Mk 1,40-42) Jesus hat den Aussätzigen also nicht nur aus geziemender Entfernung geheilt. Nein, er hat ihn berührt. Er hat ihn angefasst. Und damit hat er eine Schranke durchbrochen. Das „er streckt die Hand aus und rührt ihn an“ ist nicht ein Ornament, nicht eine Verzierung der Erzählung. Es ist ein elementarer Vorgang – gegen die Hygiene, gegen den Anstand, gegen die Regel, gegen die Tora. Warum rührt Jesus den Aussätzigen an? Es hat mit seiner Proklamation der Gottesherrschaft zu tun.
Mit dem Auftreten Jesu wird in Israel und über Israel in der ganzen Welt die Schöpfung neu. Sie wird so, wie sie gedacht war und wie sein sollte: unverdorben, morgenfrisch, schön, geheilt, befreit von dem Aussatz der Erde. Deshalb muss Jesus Kranke heilen, Besessene befreien, Aussätzige rein machen, Dämonen austreiben. Und deshalb muss er die Kranken berühren. Denn zu einer befreiten und geheilten Welt gehört auch, dass die Gemeinschaft wiederhergestellt wird, dass alle soziale Isolation handgreiflich beendet wird. … Wenn also der Aussätzige zu Jesus sagt: „Wenn du willst, kannst du mich rein machen“, so schreibt er Jesus göttliche Macht zu. Er ist erfüllt von einem letzten Vertrauen. Er glaubt, dass in Jesus Gott selbst handelt. Er vertraut sich Jesus an.
Er erwartet von ihm alles.
Und wir? Würden wir genauso bitten wie der Aussätzige? Würden wir mit demselben Vertrauen flehen? Flehen wir Jesus an, wenn wir in Not sind? Fallen wir vor ihm auf die Knie? Erzählen wir ihm die ganze Not unseres Lebens? Rechnen wir in grenzenlosem Vertrauen, dass er uns hilft und uns aus unserer Not herausholt? Vielleicht tun wir es. Vielleicht tun
wir es auch nicht. Und wenn wir es nicht tun, kann es viele Gründe haben.
Ein Grund, der gerade bei gläubigen Menschen nicht selten eine Rolle spielt, kann der folgende sein: Wir wagen es nicht, Gott in eigener Sache um Hilfe zu bitten. Dürfen wir denn Gott mit unseren persönlichen Nöten, mit unseren Krankheiten, mit unseren Unfällen, mit unseren Problemen, mit unseren Angelegenheiten und Vertracktheiten um Hilfe anflehen? Muss es bei unserem Beten nicht um das Große und Ganze gehen, um die Not der Welt,
um das Elend der Gesellschaft, um die Sache der Kirche – eben um das Reich Gottes?
So könnte gerade ein frommer und gläubiger Mensch denken, und dann wagt er es nicht mehr, Jesus in seiner persönlichen Not anzuflehen. Hat er recht? Ich meine nicht. Er hätte nur dann recht, wenn seine persönliche Not und wenn seine persönlichen Lasten gar nichts mit dem Reich Gottes zu tun hätten. Und das wäre tatsächlich der Fall, wenn er nur für sich selbst leben würde, nur sich selbst im Blick hätte, nur an sein eigenes Glück und Wohlbefinden denken würde. Lebt er hingegen im Glauben, in der Hoffnung und in der
Liebe – ist sein Leben grundsätzlich ausgerichtet auf Gott und den Willen Gottes – dann darf er alles erbitten, dann darf er Großes für sich erbitten und selbst um die Überwindung der kleinen Nöte seines Lebens Jesus anflehen. Denn er sucht ja zuerst das Reich Gottes.
Und dann darf er erwarten, dass ihm „alles andere dazugegeben wird“ (Mt 6,33).